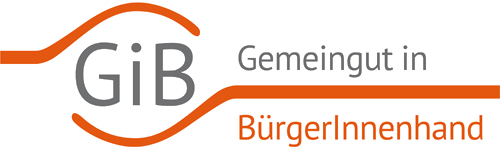Von Carl Waßmuth, zuerst erschienen in der Frankfurter Rundschau am 18.09.2013
Bei Public Private Partnership (PPP, deutsch: ÖPP, Öffentlich Private Partnerschaft) plant, baut und betreibt eine private Firma eine öffentliche Einrichtung. Dafür bekommt die Firma über die Vertragslaufzeit von 25 bis 30 Jahren eine feste jährliche Zahlung, ähnlich einer Miete, finanziert aus Steuergeld. Die zugehörigen Verträge sind stets geheim. Nun endet eines der ersten großen Public-Private-Partnership-Projekte Deutschlands vorzeitig: In Berlin kauft der Senat die teilprivatisierten Wasserbetriebe zurück. Ein Volksentscheid hatte die Offenlegung der Geheimverträge erzwungen, skandalöse Gewinngarantien für die Investoren wurden öffentlich. Ist vom einstigen Heilsbringer PPP der Lack ab?
Kritiker bewerten PPP als teuer und riskant. Zudem sehen sie darin einen Weg zur Umgehung von Verschuldungsobergrenzen und eine Aushebelung kommunaler Selbstverwaltung. Lobbyisten empfehlen PPP hingegen als eine günstige Lösung für die drängenden Infrastrukturprobleme, zumal in Zeiten leerer Kassen. Die OECD bezifferte 2006 den weltweiten Investitionsbedarf in die Infrastruktur bis 2030 auf 28 Billionen Euro. PPP mag wenig geliebt werden – aber als Modell ist es auf dem Vormarsch, ja wird zum Prinzip von Investitionspolitik erhoben.
PPP ist versteckte Verschuldung
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung zur europäischen Schuldenkrise die nächste PPP-Generation vorgestellt: Die Daseinsvorsorge soll künftig auch mit so genannten „Projektanleihen“ gebaut und erhalten werden. Die Europäische Investitionsbank wird dafür Kredite geben. Es scheint ein Widerspruch: Öffentliche Verschuldung ist die zentrale Triebkraft für PPP. Tatsächlich ist es fiskalische Doppelmoral, denn faktisch werden die Schulden versteckt: Mietzahlungen gelten haushaltstechnisch nicht als Neuverschuldung. In Griechenland war das „böse“, mit der Förderung von PPP unterläuft Europa jedoch selbst gezielt die Maastricht-Kriterien.
PPP ist teuer
Das Versteckspiel hat seinen Preis. PPP-Projekte werden von den Rating-Agenturen üblicherweise als riskant bewertet: „BBB“ oder schlechter. Die Rechnungshöfe warnen immer wieder vor den hohen Kosten durch PPP. Die geplante Privatisierung eines Abschnitts der Autobahn A 7 käme mindestens 13 Millionen teurer als die Eigenerledigung, befand der Bundesrechnungshof. Die niedersächsische Straßenverwaltung geht sogar von 25 Millionen Euro Mehrkosten für die PPP-Variante aus. Vielleicht ist es auch noch mehr, ganz genau kann man das nicht wissen: In Deutschland fehlt jede offizielle Auswertung der bisher knapp 400 PPP-Projekte. Milliarden Euro werden ausgegeben mit der Behauptung, das sei wirtschaftlicher als die Erbringung durch die öffentliche Hand – doch niemand prüft das nach.
PPP braucht Geheimhaltung
Was der Staat selbst nicht wissen will, soll auch niemand sonst erfahren. PPP-Projekte werden daher in Geheimverträgen geregelt. Rechtliche Auseinandersetzungen zu den Verträgen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Toll Collect, ein gewaltiges PPP-Projekt, startete 16 Monate verspätet, die öffentliche Hand erlitt Milliarden Euro an Verlusten. Vor dem geheim tagenden Schiedsgericht wurde in neun Jahren nicht ein Cent erstritten. Für diese Leistung wurden Beratern fast 100 Millionen Euro bezahlt.
Das Risiko tragen die Bürgerinnen und Bürger
Jedes PPP-Projekt in Deutschland wird über eine eigene Projektgesellschaft abgewickelt, deren haftendes Eigenkapital meist bei 25 000 Euro liegt. Schließen große Firmen untereinander Verträge, kommt es ebenfalls vor, dass eine kleine GmbH im Zentrum steht, etwa eine Tochterfirma mit besonderem Fachpersonal. In einem solchen Fall wird regelmäßig eine Erklärung zur Unternehmenshaftung verlangt. Damit sichert man ab, dass für einen durch die Tochterfirma verursachten Schaden der solvente Mutterkonzern haftet. Bei PPP verlangt der Staat hingegen nie eine Unternehmenshaftung. PPP-Firmen können ihm so jederzeit mit Insolvenz drohen.
Aber auch bei großen Kapitalgesellschaften macht sich der Staat erpressbar. Die PPP-Partner der Berliner Wasserbetriebe, RWE und Veolia, durften jahrelang im Vergleich der deutschen Großstädte die höchsten Wasserpreise nehmen. Als es den Berlinerinnen und Berlinern zu bunt wurde und sie die Politik massiv unter Druck setzten, musste der Senat den Rückkauf einleiten. Doch die beiden Firmen konnten noch einmal einen gewaltigen Rückkaufpreis einfordern. Ohne diesen goldenen Handschlag hätten sie weiter auf Erfüllung ihrer Verträge gepocht und die Politik als zahnlos entlarvt. Der Bevölkerung bleiben hochverschuldete Wasserbetriebe mit einer kaputtgesparten Infrastruktur.
Infrastruktur wird in der Substanz gefährdet
PPP ermöglicht es der Politik, weiter bei Eröffnungen Bänder durchzuschneiden. Der Zweck von Daseinsvorsorge ist aber nicht, die Kulisse für Wahlkampfbilder abzugeben. Auf Daseinsvorsorge kann nicht verzichtet werden. Ohne Wasser kann man nicht leben, ohne Bildung, ohne Teilhabe an Mobilität, ohne Versorgung bei Krankheit ist ein Dasein in Würde nicht möglich. Privatfirmen werden die Verantwortung für diese Aufgaben nie übernehmen.
Wird das Modell PPP ausgeweitet, geht es womöglich bald nicht mehr nur darum, ob alles teurer wird als geplant, sondern um die Frage, ob die Infrastruktur überhaupt noch funktioniert. Die Daseinsvorsorge ist dann endgültig Geisel der Investoren.
***
Der Autor: Carl Waßmuth ist Mitbegründer von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) und Sachverständiger für Infrastruktur. GiB setzt sich für die demokratische Steuerung der Daseinsvorsorge ein. Aktuell sammelt GiB unter www.gemeingut.org Unterschriften zum Stopp von PPP-Vorhaben. Der Brief soll den am Sonntag neu gewählten Bundestagsabgeordneten vorgelegt werden.