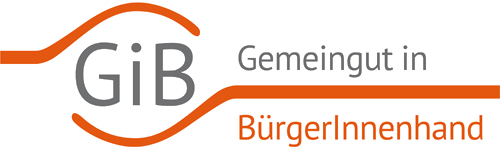Von Carl Waßmuth / GiB
Vergangenes Jahr im November wurde in Berlin über die Rückholung der Stromnetze in Berlin abgestimmt. Sechs Wochen hatte Hamburg die Wahl, seine Netze zurückzuholen. Im Vorfeld dieser beiden Volksentscheide erschien im Berliner „Tagesspiegel“ ein Essay zu Rekommunalisierung1. Der Autor Carsten Brönstrup hatte eine „neue Lust an der Verstaatlichung“ ausgemacht und äußerte die Befürchtung, dass künftig zu viel rekommunalisiert wird. Ulrike von Wiesenau vom Berliner Wassertisch2 und Prof. Jürgen Schutte von „Gemeingut in Bürgerinnenhand (GiB)“3 hatten das Essay damals analysiert und verschiedene Begriffsverdrehungen aufgedeckt. In Hamburg wurde die Rekommunalisierung beschlossen. In Berlin stimmte eine große Mehrheit für die Rekommunalisierung, das Quorum wurde jedoch verfehlt. Bezogen auf die Entwicklung der Energie-Volksentscheide könnte man nun sagen: unentschieden. Der besagte Beitrag von Brönstrup hatte aber eine spezifische Zielrichtung, die über tagespolitische Kämpfe hinausgeht, und er ging dabei auch formal neue Wege. Im Kern wurde Daseinsvorsorge an sich negiert. Für die Privatisierung der zugehörigen Infrastrukturen wurde ein neuer Rosenteppich ausgebreitet – den Sigmar Gabriel nun mit seinem Vorschlag für privates Kapital in öffentlichen Infrastrukturen prompt beschreitet. Es soll deswegen nachfolgend dieser Beitrag von Carsten Brönstrup gewürdigt und seine Aktualität hervorgehoben werden.
Ein altes Privatisierungsgedicht…
In den neunziger Jahren waren häufig Privatisierungshymnen in Tageszeitungen und Magazinen zu lesen. Gleichzeitig wurde auch auf Teufel komm raus privatisiert: Die Treuhand privatisierte Firmen und Immobilien im geschätzten Wert von 300 Milliarden Euro und schloss dennoch mit 150 Milliarden Euro Schulden ab. Die Telekom ging an die Börse, die Post wurde verkauft, die Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. Der Börsengang der Bahn wurde abgebrochen, 84 Prozent der Bevölkerung sprechen sich gegen Privatisierungen oder sogar für die Rekommunalisierung bereits privatisierter Daseinsvorsorge aus. Dementsprechend sind Zeitungsbeiträge zu Privatisierung heutzutage selten und bezüglich neuer Privatisierungen zumeist kritisch. Der Beitrag Brönstrups ist seit Jahren der erste Artikel einer großen Tageszeitung, der mit diesem Trend bricht.
…wird jetzt gerappt
Nun ist es vermutlich nicht ratsam, das Lied der Privatisierung einfach wieder neu anzustimmen, wenn man nicht als gestrig gelten will. Und Brönstrup tut das auch nicht. In einer Art Hip-Hop-Gedicht mischt er kreativ Altes mit Neuem. Er rezipiert, dass Privatisierung negative Gefühle auslöst. Er entfacht ein Wetterleuchten an Assoziationen, die er jeweils nicht erläutert, sondern wie mit in einer Art Bass-Beat mit seiner sehr eigenen Deutung unterlegt. Es entsteht ein dem ersten Anschein nach gut informierender und ausgewogener Beitrag zum Thema Privatisierung und Rekommunalisierung von nahezu lyrischer Qualität. Für und Wider wechseln sich ab, Beispiele beider Seiten werden genauso angeführt wie Zeugen beider Positionen. Kurzum: Brönstrup findet eine eigene und bemerkenswert neue Form, in der die von Schutte und von Wiesenau aufgezeigten Verdrehungen nur einen Teil des Ganzen darstellen.
Diskreditieren statt argumentieren
Bevor Brönstrup in seinem Beitrag zu eigenen Aussagen kommt, definiert er implizit zentrale Begriffe des Diskurses um. So setzt Brönstrup Rekommunalisierung mit Verstaatlichung gleich. In keinem der Volksbegehren zu Rekommunalisierung taucht allerdings die Forderung nach Verstaatlichung auf. Im Gesetzesvorschlag zur Rekommunalisierung der Berliner Stromnetze werden sogar Regelungen getroffen, die den BürgerInnen an vielen Stellen Mitwirkung und Kontrollrechte einräumen – aus Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen. Die sich nach dem englischen Wort für Gemeingüter bezeichnende „Commons“-Bewegung lokalisiert sich selbst als „jenseits von Markt und Staat“. Der Unterschied zwischen Verstaatlichung und Rekommunalisierung mag als Nuance vorkommen. Hinsichtlich der hervorgerufenen Assoziationen sind es Welten, und Assoziationen sind elementares Stilmittel des Essays.
Auch die Kritik an Privatisierung selbst wird verzerrt. „Privatisierung“ sei ein Wort mit gefährlichem Beiklang geworden, Marktskeptiker würden mit ihm Stimmung gegen das vermeintlich neoliberale Böse machen und gleichzeitig für die ordnende Hand des Staates schwärmen. Dazu Prof. Schutte: „Die Gegner des Ausverkaufs öffentlicher Einrichtungen an private Unternehmen erscheinen als naive Ideologen, die im Neoliberalismus die Inkarnation des Gottseibeiuns sehen und den Staat ungeheuer cool finden. Klar, dass diese Sicht nur desorientierten Köpfen entsprungen sein kann.“ Wer an das neoliberale Böse glaubt, der hat vermutlich auch noch Angst vor dem Teufel, ist also vorrational oder irrational. Eine Auseinandersetzung mit Argumenten zu erwarten, wäre hier, so wird unausgesprochen unterstellt, vergebliche Liebesmüh.
Ein Kabarettist als Zeuge, braune Brühe als Bild
Für Rekommunalisierung setzen sich Bundestagsabgeordnete aller im Bundestag vertretener Parteien ein, Gewerkschaften, Ingenieure, Krankenschwestern, Ärzte und viele mehr. Brönstrup zitiert jedoch Horst Evers. Der ist ein kluger und auch bekannter Kabarettist. Allerdings gehört es zum Charakter von Kabarett, dass viele Aussagen einen zweiten oder dritten Boden haben. Im von Brönstrup angeführten Zitat steckt denn auch gar kein Argument, sondern nur die – womöglich ironische – Verstärkung der Aussage selbst: Rekommunalisierung sei „unglaublich sinnvoll“. Man hätte durchaus auch den langjährigen Verfassungsrichter und Wissenschaftler Prof. Siegfried Broß zitieren können: „Mit der Privatisierung öffentlicher Infrastruktur war der Verlust von schätzungsweise 1,2 Millionen regulären Arbeitsverhältnissen verbunden“.4
Zum Beitrag gehört ein Bild, in dem eine braune Brühe einen Abwasserkanal entlang fließt. Darunter steht: „Saubere Sache? Nicht immer. Wem ein Wasserbetrieb gehört, der muss auch im Dreck wühlen können.“ Was soll das bedeuten? Dass romantisierende Anhänger einer Rekommunalisierung stets nur das klare Trinkwasser vor dem inneren Auge haben? Immerhin sind 80 Prozent aller Wasserbetriebe in Deutschland weiterhin öffentlich. Das „Wühlen im Dreck“ sollte also für die öffentliche Hand nicht so neu und unerwartet auftreten wie angedeutet. Wertend sind auch Verben und Attribute : Befürworter von Rekommunalisierung empfinden eine „Lust an der Verstaatlichung“, „Markt gilt [ihnen] als anrüchig“, sie „machen Stimmung“ oder „schwärmen“. Diskreditierung ist Brönstrup sogar so wichtig, dass er Inkonsistenzen in Kauf nimmt: Die Befürworter von Rekommunalisierung sind nämlich eingangs ganz kalt kalkulierend und „erzkapitalistisch“, „ein Deal geht über die Bühne“, nach einem „Plan wie aus dem Lehrbuch für Investmentbanker“. Dann handelt man aber doch nach „Gefühl“, das als eher diffus beschrieben wird und eine wenig ausgeprägte Rationalität suggeriert. Dann wird wieder Geldgier unterstellt: „Der Blick auf die Rendite ist entlarvend“, die „Privatisierungsskeptiker […] schielen aufs Geld“. Was auch immer es ist, berechnend oder emotional, es hat stets eine negative Konnotation zulasten der Kritiker von Privatisierung.
Die Welt besteht aus Konzernen
Wie schafft es Brönstrup aber nun, das Für und Wider scheinbar ausgewogen darzustellen und doch zu einer völlig einseitigen Position zu gelangen? Indem er das Wider einkapselt. In einem knappen Absatz fasst Brönstrup die Kritik an zwei Jahrzehnten Privatisierungspolitik zusammen: „Doch der erträumte Segen durch die Privatisierungen blieb in vielen Fällen aus. In Berlin stieg der Wasserpreis auf Rekordhöhe, der Versorger Vattenfall baute zehntausende Stellen ab. Auch andernorts entließen Stromfirmen Leute zu Tausenden, ebenso wie die Telekom, die Bahn, die Post, die Lufthansa oder ehemals öffentliche Krankenhäuser. Wer seinen Job behielt, hat heute oft mehr Stress, weniger auf dem Lohnzettel und keine Garantie, dass er auch im nächsten Monat noch beschäftigt sein wird. Die Post schloss Filialen und schraubte Briefkästen ab, Mieter vormals staatlicher Wohnungen beklagen steigende Mieten und schlechteren Service. Und bei der privatisierten Altersversorgung über Riester und Rürup fürchten viele, dass ihre Beiträge vor allem die Taschen der Versicherungsvertreter füllen, statt im Alter ein auskömmliches Leben zu garantieren.“ Das ist kein schlechter Rundumschlag. Viele werden diesen Beobachtungen zustimmen. Gemäß den Regeln der Dialektik kommen nun die Pro-Argumente. Auf dem Weg dorthin versteckt Brönstrup jedoch eine wichtige Wertung: „Hat der Staat in einem Konzern das Sagen, läuft es aber nicht zwangsläufig besser.“ Damit wird unterstellt, dass es immer um Konzerne gehen muss. Unter einem Konzern wird landläufig ein privatrechtliches Unternehmen verstanden, kaum jemand würde eine in öffentlicher Regie organisierte Wasserversorgung vorrangig als Konzern charakterisieren. Durch die implizite Einschränkung aufs Privatrecht klammert Brönstrup die komplette Diskussion um die formelle Privatisierung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge aus. Dass durch diese formelle Privatisierung bereits massive Schäden am Gemeinwohl entstehen können, wird weiter unten noch dargestellt. Festzuhalten ist hier: Bei Brönstrup sind solche Erscheinungen der Schädigung keine Privatisierungsfolge, sondern die Folge von zu wenig Privatisierung.
Formelle Privatisierung
Die Umwandlung von einer Gesellschaft öffentlichen Rechts in eine privatrechtliche Organisationsform ist einer von zwei Schritten von Privatisierung. Diese sogenannte formelle Privatisierung zeitigt nicht selten schon einen Großteil der auch von Brönstrup beschriebenen negativen Folgen. Die Deutsche Bahn AG wurde vor 20 Jahren formell privatisiert. Seither hat sie mehr als die Hälfte der ehemals im Bahnbereich vorhandenen Stellen abgebaut, hat 375 Milliarden an Steuergeldern verschlungen, Grundstücke im Wert von vielen Milliarden Euro geradezu verschleudert, tausende Kilometer Strecken stillgelegt und ihre Brücken und Tunnel verrotten lassen.5 Es spielt eine zentrale Rolle für die Möglichkeit demokratischer Kontrolle, ob eine Einrichtung der Daseinsvorsorge in Form einer öffentlichen Verwaltung, eines Eigenbetriebs, einer Anstalt öffentlichen Rechts oder eben als Genossenschaft, Kommandit-Gesellschaft, GmbH oder Aktiengesellschaft organisiert wird. Das gilt auch für legale und illegale Korruption. Brönstrup lastet der öffentlichen Hand einen „Ruch von Filz und Vetternwirtschaft“ an. „Legion sind die Beispiele für Politiker, die von Parteifreunden mit einträglichen Pöstchen versorgt wurden. Und die sich hinterher eher um ihr eigenes Wohlergehen kümmerten als um das ihrer Kunden und Eigentümer.“ Die einträglichen Pöstchen gab es aber nur in privatrechtlichen Unternehmen. Roland Pofalla kann nur in einer Aktiengesellschaft 1,2 Millionen Euro Jahresgehalt beziehen, das viereinhalbfache der Jahresbezüge der Bundeskanzlerin.
Der formellen Privatisierung folgt oft die Kapitalprivatisierung, und hier und nur hier taucht bei Brönstrup der Begriff der Daseinsvorsorge auf: „Selbst die Daseinsvorsorge, die bis dato als Domäne des Staates galt, kam nun in private Hände. Mancherorts hat das gut funktioniert, ist unternehmerisches Denken in einstige Beamtenapparate eingezogen.“ Brönstrup geht davon aus, dass der Verkauf der Daseinsvorsorge zumindest zuweilen gut funktioniert und dass das soll ein Erfolg der Kapitalprivatisierung ist. Nachteile sind hingegen nicht das Ergebnis der formellen Privatisierung – die Brönstrup ja gar nicht kennt -, sondern eines Versagens von Politik und öffentlicher Hand.
Was der Markt hält …
Brönstrup nennt eine Handvoll Beispiele, die positive Auswirkungen von Privatisierungen belegen sollen: „Auf der anderen Seite gibt es viele Fälle, in denen der Markt gehalten hat, was seine Anhänger zuvor versprochen hatten.“ Diese Beispiele sind sehr knapp gehalten und sollen günstigere Preise und bessere Qualität aufzeigen. Zahlen fehlen – und sie fehlen oft, wenn diese durchaus gängigen Vorstellungen angesprochen werden. Zahlen fehlen auch bei den von Brönstrup aufgeführten Negativbeispielen für staatliche Misswirtschaft. Es gibt jedoch zu beidem durchaus Zahlen, und sie zeichnen ein gänzlich anderes Bild. Nachfolgend soll für die Beispiele Telekom, Energie, Banken, Bahn und Fernbusse hinterfragt werden, welche Segnungen Privatisierung im betreffenden Sektor mit sich gebracht haben.
… bei der Telekom
Die Erfolgsstory der Deutschen Telekom ist in vielen wettbewerbsfreundlichen Beiträgen das Vorzeige-Beispiel schlechthin, so auch bei Brönstrup: „Seit dem Ende der Deutschen Bundespost kosten Telefongespräche nur noch den Bruchteil der Preise von einst – von der besseren Qualität und den Segnungen der mobilen Kommunikation zu schweigen.“ Es ist etwas Platz wert, diese Legende zu entzaubern.
Dass die Preise für Telefongespräche so stark gesunken sind, ist ganz überwiegend dem technischen Fortschritt in diesem Bereich zuzuschreiben. Der Preisverfall war weltweit im gleichen Zeitraum nahezu parallel in zahllosen entwickelten Ländern zu beobachten, und zwar unabhängig davon, ob im betreffenden Land der Telekommunikationssektor schon liberalisiert, die Telefongesellschaft schon verkauft worden war oder noch nicht.
Besseren Service, ein häufiges Versprechen von Marktanhängern, führt Brönstrup in der Liste seiner Segnungen übrigens nicht an. Es ist wohl auch ihm klar, dass allein der Gedanke an das letzte Service-Telefonat mit der Telekom auch radikalen Wettbewerbsbefürwortern die Zornesröte ins Gesicht treiben könnte.
Der volkswirtschaftliche Effekt der Privatisierung war trotz der sinkenden Tarife schlimm. Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Siegfried Broß nennt zwei Gründe: „Wir zahlen über Steuern und Sozialversicherungsabgaben für den Stellenabbau, die Pensionslasten und die Ausgründung der Beschäftigten in Personal-Service-Agenturen.“ Prof. Tim Engartner von der Frankfurter Goethe-Universität nennt dazu Zahlen: „Von 1994 bis 2007 baute die Telekom im Inland rund 77 000 Arbeitsplätze ab, was der Hälfte aller Stellen entspricht. Auch im Telekommunikationssektor hat die Privatisierung mehr Arbeitsplätze vernichtet als neue hinzukamen: Die Wettbewerber der Telekom haben bis 2007 lediglich 14 000 neue Stellen geschaffen.“6 Zu den Pensionslasten schreibt Engartner: „So wird der Bund bis 2076 rund 550 Mrd. Euro Witwen-, Waisen- und sonstige Renten für die ehemaligen Beamten des „Gelben Riesen“ [die ehemalige deutsche Bundespost, aus der die deutsche Post AG und die Telekom AG hervorgingen, Anm. C.W.] zahlen.“
Dazu kommt, dass der späteren Telekom ein großes Brautgeschenk beigegeben wurde: „Unmittelbar nach der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten legte der Bund ein Investitionsprogramm in Höhe von 55 Mrd. DM auf. Mit diesen Mitteln errichtete die Bundespost kurz vor dem Börsengang auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eines der weltweit leistungsfähigsten Telekommunikationsnetze – das dann kurz darauf unter den Hammer kam.“ (Engartner) Der Börsengang erfolgte in drei Tranchen und brachte insgesamt trotz New-Economy-Hype nur 35,9 Mrd. Euro ein. Im Staatsbesitz bleiben direkt 14,5 Prozent und indirekt über die KfW weitere 17,4 Prozent der Aktien, die zusammen heute 17,4 Mrd. Euro wert sind. Börsengang plus Restwert zusammen machen 53,3 Mrd. Euro aus. Zieht man die Einmal-Investition ab, bleiben 25 Milliarden Euro Erlös für den Wert der ganzen Immobilien und Marken. Zieht man die Pensionszahlungen ab, bleiben über 500 Milliarden Euro Kosten.
… im Energiesektor
Bei der Energieversorgung sieht Brönstrup zu viel Staat: „Von den vier großen Stromkonzernen hierzulande gehört nur Eon allein privaten Eigentümern. Bei allen anderen mischt die Politik mit – und doch steigen die Preise seit Jahren beinahe ohne Pause.“ Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Bei der Telekom lobt Brönstrup die fallenden Preise und stört sich nicht am verbleibenden staatlichen Einfluss über immerhin 31,9 Prozent der Aktien. Im Strombereich hat es mit dem Preisverfall nicht geklappt. Daran sind nun aber nicht die private Rechtsform und die privaten Anteilseigner schuld, sondern die Aktien in Staatsbesitz. Der Energiesektor unterlag einer beispiellosen Privatisierung. Gewaltige Infrastrukturen wie die Hochspannungsnetze wurden verramscht, enorme Produktionskapazitäten weitgehend privatisiert, tausende Stadtwerke und kommunale Energienetze teilprivatisiert oder verkauft. Herausgebildet hat sich das bekannte Oligopol aus Eon, RWE, EnBW und Vattenfall. RWE hat noch 25 Prozent kommunale Anteilseigner, der Rest ist in Privatbesitz. 45 Prozent der EnBW-Anteile gehörten von 2000 bis 2010 dem börsennotierten und teilprivaten französischen Staatskonzern Électricité de France (EDF) und kamen nach einem hochumstrittenen, weil überteuertem Rückkauf zum Land Baden-Württemberg zurück. Vattenfall AB ist vollständig im Besitz des schwedischen Staates, aber privatwirtschaftlich organisiert und durch zahllose Aufkäufe zum fünftgrößten Stromerzeuger in Europa aufgestiegen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben folgende Eigentumsverhältnisse: 50Hertz: Vollständig privat, Amprion: noch 35,1 Prozent der Anteile bei RWE), Tennet: zu 100 Prozent im Besitz des niederländischen Staates. Im Gesamtbild ergibt sich somit ein Sektor, der zahlreichen Verkäufen unterliegt und in dem die Bundesrepublik Deutschland nur noch wenige Anteile zurückbehalten hat. In wieweit das staatliche Engagement anderer Länder im deutschen Strommarkt qua politischer Einflussnahme preissteigernd wirkt, lässt Brönstrup offen. In jedem Fall sind es nur noch das Land Baden-Württemberg, sowie einige Kommunen in Nordrheinwestfalen und Baden-Württemberg die auf deutscher Seite für die von Brönstrup angeführten negativen Effekte verantwortlich sein könnten. Zu alldem schreibt Brönstrup über die augenfälligen Charakteristika der Branche nichts: Das unverwüstliche Oligopol, an dem auch massive Eingriffe von Kartellämtern in Deutschland und Europa abperlen, ist ein geradezu klassisches Beispiel von Marktversagen. Die preisbildenden Vorgänge an der Leipziger Strombörse waren wiederholt sogar Gegenstand staatsanwaltlicher Untersuchungen.
… bei den Banken
2007 begann eine Weltwirtschaftskrise. Private Banken und Investmentgesellschaft hatten sich in einem zuvor nicht vorstellbaren Ausmaß verspekuliert und gerieten ins Trudeln. Weil sie als „too big to fail“ eingestuft wurden, also weil man fürchtete, dass der Bankrott dieser privaten Geldhäuser die Volkswirtschaften noch stärker schädigen würde als die von ihnen ohnehin verschuldete Kreditkrise, wurden sie weltweit mit insgesamt über zwei Billionen Euro an Steuergeldern „gerettet“. Auch öffentliche Banken hatten sich jede Menge giftiger Finanzprodukte ins Portfolio gelegt. Brönstrup sieht die schlechten Erfahrungen dieser Krise überraschenderweise ausschließlich bei den öffentlichen Banken: „Mit einer Landesbank hat nicht nur Berlin schlechte Erfahrungen gemacht. Auch Staatsbanker in Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zockten auf dem Finanzmarkt und hinterließen den Bürgern Milliardenlasten.“ Durch die Weglassung der ein Vielfaches höheren Schädigungen durch Privatbanken für BürgerInnen und Volkswirtschaften wird diese Aussage irreführend, ja absurd. Zunächst haben die Privatbanken die toxischen und zerstörerischen Finanzprodukte überhaupt erst entwickelt und in Verkehr gebracht. Daran, immerhin waren die Staatsbanken nicht beteiligt. Hätten die Privatbanken nur so viel gezockt wie die Staatsbanken, wäre nur ein Bruchteil des Schadens entstanden. Die Billionen Euro für Rettungsschirme dienten ganz überwiegend der Rettung von Privatbanken und nur am Rande von mitbetroffenen Staatsbanken.
… bei der Bahn
Eine Zeugin für missliche Staatswirtschaft ist für Brönstrup die Bahn: „Und die Deutsche Bahn, der letzte große Staatskonzern, produziert unablässig Skandale – vom Personalmangel in Stellwerken über Sparorgien bei der Berliner S-Bahn bis hin zur ewigen Unpünktlichkeit.“ Die Deutsche Bahn ist tatsächlich zu 100 Prozent und nicht wie die Telekom nur noch zu 31,9 Prozent in Bundesbesitz. Es ist jedoch eine Frage der Sichtweise, ob man die zweifellos skandalöse Kundenferne der Deutschen Bahn dem Bundesbesitz zuschreibt und nicht der formellen Privatisierung und den Plänen, die Bahn an die Börse zu bringen. Eine lange Reihe parlamentarischer Anfragen hatte zum Inhalt, ob die Politik die DB AG nicht endlich im Sinne der Kunden, der Umwelt und der Steuerzahlenden steuern könne. Sie wurden alle unisono mit demselben Verweis abgeschmettert: „Eine Steuerung der DB AG durch die Politik ist leider nicht möglich, da sie privatwirtschaftlich organisiert ist.“
… und bei Fernbussen
Ein weiteres Positivbeispiel, in dem der Markt gehalten hat, was zuvor versprochen wurde, sind für Brönstrup die Fernbusse: „Seit nicht mehr allein die Bahn Fernbus-Verbindungen anbieten darf, sind bundesweit Dutzende neue Strecken zu attraktiven Preisen entstanden.“ „Dutzende Strecken“ werden jedoch nicht ausreichen, um den Bahnverkehr zu substituieren, wie der Verkehrsexperte Dr. Winfried Wolf vorrechnet:7 „Die Zahl der auf der Schiene beförderten Personen liegt jährlich bei 120 Millionen Fahrgästen im Fernverkehr und bei weiteren 2,1 Milliarden Fahrgästen im Nahverkehr. Insgesamt werden also täglich rund sechs Millionen Menschen in Eisenbahnen transportiert. Um diese Menschen zu einem größeren Teil mit Bussen zu befördern, bedürfte es einer Armada von vielen Hunderttausenden Bussen. Das ist strukturell kaum vorstellbar. Man benötigte ja nicht nur die Transportmittel, sondern auch eine entsprechend umfangreiche neue Infrastruktur mit riesigen Busbahnhöfen – wie es sie teilweise auch in der Dritten Welt, so in Mexiko, gibt. Es wäre unter solchen Bedingungen auch kaum vorstellbar, dass diese Busse, wie die Eisenbahnen, die Stadtzentren ansteuern könnten. Sie würden in Staus hängenbleiben; eine Zeitzuverlässigkeit könnte nicht gewährleistet werden – ein ″Linienverkehr″ wäre damit nicht darstellbar“.
Was die Preise betrifft, so konstatiert Wolf: „Unter den aktuellen Bedingungen können Bus-Linienverkehre Fahrten zu Preisen anbieten, die bei der Hälfte und einem Drittel der Bahnfahrkartenpreise liegen. […] Die verschiedenen Berechnungen der externen Kosten des Verkehrs belegen, dass vor allem der Straßenverkehr der Gesellschaft enorme Kosten aufbürdet, die nicht in den Fahrpreisen enthalten sind. Es gibt konkrete Berechnungen, wonach der Lkw-Verkehr deutliche höhere externe Kosten als der Pkw-Verkehr verursacht – unter anderem durch die massive Abnutzung der Infrastruktur (der Straßen und Brücken), die durch die hohen Lasten der Nutzfahrzeuge verursacht werden. Die Steuern und Mautgebühren, die Lkw bezahlen, decken nur 30 bis 40 Prozent der Kosten, die sie im Straßennetz verursachen. Rechnete man […] diese Kosten in den Busbetrieb ein, müssten sich die Fahrpreise im Bus-Linienverkehr, grob geschätzt, mehr als verdreifachen.“
Die Schuldenbremse als Hebelpunkt
Brönstrup führt nun den wichtigen Sachzwang der Verschuldung ein: „Womöglich versprechen die Initiatoren [der Rekommunalisierung der Energienetze in Berlin] aber mehr, als sie halten können. Geld für den Aufbau eines Versorgers haben sie nicht, die Stadt ist mit 62 Milliarden Euro verschuldet und steckt in den Zwängen der Schuldenbremse. Investitionen, die in die Energie flössen, fehlten bei der Sanierung von Schulen und Straßen – das wäre eine bedenkliche Umverteilung. Zumal heute noch nicht absehbar ist, wie viel Geld in ein paar Jahren in die Netze gesteckt werden muss.“ Das Argument der Verschuldung wird nicht weiter begründet, Brönstrup kann sich auf eine breite Ablehnung von öffentlicher Verschuldung stützen. Und tatsächlich schränkt öffentliche Verschuldung oft die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand ein. Zudem fließen mit den Zinsen Steuergelder an die Banken ab, die dem Gemeinwohl im Weiteren nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Extremfall kann eine zu hohe Verschuldung eine ganze Volkswirtschaft destabilisieren. Allerdings muss gesagt werden, dass es ohne Schulden kein Geld und auch keinen Wirtschaftskreislauf gäbe. Schulden an sich zu verurteilen ist ökonomisch blödsinnig. Schulden, die bei der öffentlichen Hand durch Privatisierungen der Daseinsvorsorge verbleiben, stehen keine künftigen Einnahmen zum späteren Ausgleich gegenüber. Alle unsere Verkehrswege, die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung, die ganze öffentliche Daseinsvorsorge wurden mit öffentlichen Schulden finanziert – die alle, sofern sie nicht jüngsten Datums sind, wieder abbezahlt wurden. Denn diese Schulden waren tatsächliche Investitionen, da sie später wieder zu Einnahmen führten.
In welcher Hinsicht gefährdet nun die Rekommunalisierung der Energienetze die Sanierung von Straßen und Schulen? Auch der gewählte Gegensatz ist vermutlich nicht zufällig: Wer andeutet, etwas könne zulasten von Familien und Autofahren gehen, hat mit nur zwei von geschätzten hundert möglichen Haushaltspositionen eine große Anzahl von LeserInnen alamiert: 32 Millionen von 80,7 Millionen Deutschen sind Autofahrer, 25 Millionen sind Eltern. Man hätte auch die Kürzung der Rüstungsausgaben als mögliche Konsequenz angeben können, das wäre vielen vielleicht als deutlich weniger bedrohlich erschienen. Nun wird von Brönstrup der Eindruck erweckt, dass bei einer Rekommunalisierung der Energienetze Milliarden Euro an Mehrkosten entstehen, nicht aber bei einer Vergabe an Privatkonzerne. Die Energiewende ist jedoch ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Sie erfordert Investitionen und einen Umbau von Infrastruktur. Das alles ist Teil eines Prozesses, der so demokratisch oder wenig demokratisch ist wie unsere Gesellschaft insgesamt. Kosten entstehen unabhängig davon, welche Netze kommunal und welche privat betrieben werden, ja Kosten entstehen selbst dann, wenn der Umbau nicht vorgenommen wird.
Des Pudels Kern: hier ist es ein verkürztes Adam Smith-Zitat
Brönstrup hat die Kritiker von Privatisierung wenig schmeichelhaft geschildert: Teils berechnend, teils gefühlsduselig, weitgehend ohne Argumente, mit obskuren Zeugen und vorrational. Die Kommunalisierungen sind in Position gebracht: Privatisierungen sind zwar irgendwie negativ, aber keine Privatisierungen eben auch. Seine Beispiele sollen zeigen: Beim Staat herrscht Ineffizienz und Korruption, enorme Kosten werden verschwiegen, über denen das Damoklesschwert einer als objektiver Sachzwang dargestellten Schuldenbremse schwebt. Demgegenüber stehen zahlreiche erfolgreiche Privatisierungen, denen zugeschrieben wird, erfolgreich gewesen zu sein. Und dem steht ein Wettbewerb gegenüber, der wohltätig wirken soll: „Wettbewerb sorgt für Innovationen, geht auf Kundenwünsche ein, steigert die Effizienz und senkt die Preise.“
Für den ideologischen Kern seiner Aussagen greift Brönstrup auf Adam Smith zurück: „Es ist nicht die Wohltätigkeit des Metzgers, des Brauers oder des Bäckers, die uns unser Abendessen erwarten lässt“, schrieb der englische Moralphilosoph Adam Smith 1776. „Sondern dass sie nach ihrem eigenen Vorteil trachten.“ Dem Zitat lässt Brönstrup eine eigene Zusammenfassung neoliberaler Theorie folgen: „Auf diese Weise entfalte die „unsichtbare Hand“ des Marktes ihre Kraft, zum Wohle aller. Auf Smith stützt sich die liberale Ordnungspolitik bis heute – und auf die Hoffnung, dass die Kräfte des Kapitalismus es schon richten werden. […]“.
Allerdings gehen selbst die „bösesten“ marktradikalen Autoren nicht so weit wie Brönstrup. Angefangen von Adam Smith über Friedrich Hayek bis Milton Friedman erkennen alle Neoliberalen an, dass es Bereiche öffentlicher Aufgaben und öffentlicher Daseinsvorsorge gibt, die der Markt niemals erfassen und regeln wird, die aber gleichwohl für das Funktionieren von Handel und Gesellschaft unabdingbar sind. Bei Hayek liest sich das so: „Sie [die wünschenswerten Dienstleistungen, die von wettbewerblichen Unternehmen nicht bereit gestellt werden] schließen auch diejenigen Betätigungen ein, die Adam Smith beschrieben hat als >>öffentlichen Anstalten und Unternehmungen […] die, so vorteilhaft sie für ein ganzes Volk sein mögen, doch niemals einem einzelnen oder einer kleinen Zahl von Personen die Kosten ersetzen.<<“ (Hayek 1991)8.
Daseinsvorsorge gibt es nicht
In Brönstrups skizzierter Wirtschaftsordnung gibt es Daseinsvorsorge nicht. Die Kurzzusammenfassung seines Weltbilds schließt stattdessen mit folgendem Negativ: „Bislang hat auch noch niemand eine gesellschaftliche Institution ersonnen, die dem Markt überlegen wäre.“ Ist das nicht eine schöne Adaption von Margret Thatchers TINA-Prinzip: „There Is No Alternative“? Brönstrup schreibt seine Verteidigung der Privatisierung im Zuge der Um- und Neuorganisation der Energieversorgung durch Volksentscheide. Es lagen sehr konkrete Alternativen zur Abstimmung vor, und die Bürgerinnen und Bürger haben sich in Berlin und Hamburg mehrheitlich für diese Alternativen ausgesprochen, mal knapp, mal überdeutlich. Teuer und somit unterlegen waren hingegen die zahlreiche Privatisierungsabenteuer. Die „gesellschaftliche Institution, die dem Markt überlegen ist“ heißt Daseinsvorsorge, und sie ist eine wirklich hart erkämpfte Errungenschaft. Die Privatisierungswelle hat die Daseinsvorsorge an vielen Stellen angegriffen. Aber sie hat auch gezeigt, dass es öffentlicher, insbesondere demokratischer Kontrolle und Steuerung bedarf, wenn die Daseinsvorsorge ihrem Auftrag gerecht werden soll: Lebensnotwendiges allen zugänglich zu machen.
***
1 Carsten Brönstrup, Die neue Lust an der Verstaatlichung, www.tagesspiegel.de/meinung/essay-die-neue-lust-an-der-verstaatlichung/8790938.html
2 Ulrike Fink von Wiesenau, Der alte Wahn der Neo-Liberalen, Eine Erwiderung von Ulrike von Wiesenau auf „Die neue Lust an der Verstaatlichung“ von Carsten Brönstrup, Tagesspiegel, 15. Sept. 2013 (siehe unten)
3 Jürgen Schutte, „Die Unlust an der Verdrehung der Tatsachen“
4 Siegfried Broß, Siegfried Broß: Wasser, Gas, Strom. Warum Privatisierung kein Allheilmittel ist oder sogar die Demokratie gefährden kann, berliner-wassertisch.info/wp-content/schriftenreihe/BROSS-SZR2013.pdf
5 Carl Waßmuth, Betriebe der Daseinsvorsorge demokratisch steuern – Thesenpapier zur Deutschen Bahn, www.gemeingut.org/2014/04/betriebe-der-daseinsvorsorge-demokratisch-steuern-thesenpapier-zur-deutsche-bahn/
6 Tim Engartner, Der große Postraub, Die Privatisierung der Bundespost und ihre Folge, www.fb03.uni-frankfurt.de/49005923/Privatisierung_Der-grosse-Postraub_Blaetter_I_2014.pdf
7 Winfried Wolf, Projekt Fernbuslinien, www.bahn-fuer-alle.de/pages/bestandsaufnahme/projekt-fernbuslinien.php, 2010
8 Zitatzusammenstellung aus: Petra Dobner, Wasserpolitik – Zur politischen Theorie, Praxis und Kritik globaler Governance, Suhrkamp, 2010 www.suhrkamp.de/buecher/wasserpolitik-petra_dobner_29558.html
—————
Der alte Wahn der Neo-Liberalen
Eine Erwiderung Von Ulrike von Wiesenau
Der Autor des Essays kann oder will den Gegensatz zwischen staatlicher Verfügung und demokratischer Kontrolle, elementare Voraussetzung für eine qualifizierte Debatte, nicht erkennen. Mit dieser intellektuellen Unschärfe diskreditiert er seine scheinbar sachliche Aufzählung von Argumenten und ist von einer respektablen Aufklärungs-Leistung weit entfernt.
Nicht die Rede ist auch vom politischen Willen, der im Wasser-Volksentscheid vom 13. Februar 2011 zum Ausdruck kam und der ein wesentliches Motiv für den strategischen Rückzug des Senats und der Konzerne aus dem fatalen Projekt der „Öffentlich Privaten Partnerschaft“ gewesen sein dürfte. Die Gegner des neoliberalen Ausverkaufs öffentlicher Einrichtungen werden als naive Ideologen dargestellt, so erspart man sich die Auseinandersetzung mit den gegnerischen Argumenten.
Die Behauptung der Überlegenheit des privaten Unternehmertums, der Staat diskreditiert als langsamer, unzulänglicher Sachverwalter, die Deutsche Bahn als angeblich letzter Staatskonzern zum Kronzeugen gemacht, kommt der Autor in seiner Argumentationslinie zu Fall, machen doch die sich häufenden Pannen bei der Bahn gerade deutlich, welche Folgen Privatisierungen immer häufiger nach sich ziehen. Die Deutsche Bahn, seit ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ein privates Unternehmen, kaputtgespart, ihre Geschäftspolitik keiner demokratischen Kontrolle mehr unterworfen, wie viele andere Unternehmen der Daseinsvorsorge, mit fatalen Folgen für weite Kreise der Bevölkerung.
Doch die von der neuen direkten Demokratie- Bewegung angestrebte Rekommunalisierung hat mit einer sogenannten „Verstaatlichung“ wenig gemein. Vielmehr soll die Kontrolle über die rekommunalisierten Stadtwerke einem demokratisch legitimierten Gremium, einem Repräsentativorgan der Bürgerinnen und Bürger, überantwortet werden.
Im Falle der Berliner Wasserbetriebe einem „Wasserrat“, für dessen Konzeption aktuell beim Berliner Wassertisch die Grundlagen mit einer Berliner Wassercharta gelegt worden sind. Die Gemeingüter gehören nicht dem Staat, sie gehören der Bevölkerung und sind Kennzeichen einer entwickelten Gesellschaft, sie sind die Krongüter unserer Demokratie.
Ulrike von Wiesenau,
Berlin, 20. September 2013