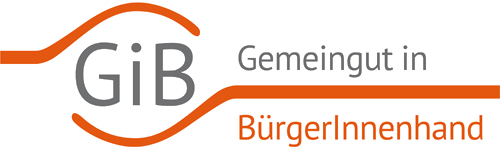Von Dr. Percy Vogel, zuerst erschienen im mdmagazin
2011 traten in Berlin zwei Initiativen zum Thema Energieversorgung an, die man leicht miteinander verwechseln konnte. Tatsächlich fiel es vielen Interessierten schwer, die Unterschiede zwischen dem Berliner Energietisch (einer Volksentscheids-Initiative) und der BürgerEnergie Berlin (BEB, einer Genossenschaft) zu benennen, zumal beide ihre Gemeinsamkeiten hervorhoben: Beide wollten weg von Vattenfall als regionalem Hauptenergieversorger und hin zu einer kohle- und atomstromfreien Energieversorgung; dazu wollten beide dem schwedischen Staatskonzern das Berliner Stromnetz entreißen und es „in Bürgerhand“ bringen. Diese Formulierung genügte, um viele Sympathien zu wecken.
Doch hinter der ähnlichen Wortwahl verbergen sich grundsätzliche Unterschiede in der Auffassung darüber, wem das Stromnetz zusteht. Während der Berliner Energietisch das im Jahr 1997 privatisierte Stromnetz über einen Volksentscheid rekommunalisieren, also wieder „in Bürgerhand“ bringen will und damit die „öffentliche Hand“ meint, will die BEB das Netz als privatrechtliches Unternehmen selbst kaufen. Die Genossenschaft wirbt um Mitglieder, die sich mit wenigstens 500 Euro beteiligen und so dem Unternehmen das notwendige Eigenkapitel zum Erwerb des Netzes (oder wenigstens eines Anteils davon) zur Verfügung stellen. Dabei benutzt sie ähnliche Begriffe wie die Rekommunalisierungs-Befürworter/innen, allerdings mit eigensinniger Umdeutung: Weil die Mitglieder ja gleichzeitig auch irgendwie „Bürger“ sind, befände sich das Netz dann ebenfalls „in Bürgerhand“. Die finanzielle Beteiligung am Netz wird entsprechend als „echte Bürgerbeteiligung“ gewertet, und diese sei außerdem „demokratisch“, weil in Genossenschaften jedes Mitglied nur eine Stimme hat, unabhängig von der Höhe der Einlage. Auch die Gewinnausschüttungen flössen dann „zu den Bürgern“, also wiederum in deren „Bürgerhand“.
„Bürgerbeteiligung“ per Einzahlung; ein kommunales Energienetz in der Hand einer Genossenschaft: Macht das aus demokratischer Perspektive Sinn? Die Frage ist nicht nur für Berlin relevant. Dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes erleben Energie-Genossenschaften seit Jahren einen Boom und stellen ein wichtiges Element der dezentralen Energiewende dar. Warum sollten sie nicht auch im Netzbetrieb tätig werden, wie die Pioniere der EWS Schönau, die 1991 das Stromnetz ihrer Gemeinde per Bürgerentscheid mit einer GmbH kauften und heute eine Netzkauf-Genossenschaft betreiben? Gelegenheit dazu gäbe es zuhauf, denn in den kommenden Jahren laufen hunderte von kommunalen Netzkonzessionen aus und stehen zur Wiederausschreibung an. Netz-Genossenschaften, die sich auf die nächsten zwanzig Vertragsjahre bewerben, stehen nicht nur in Konkurrenz zu den Konzernen, die derzeit die Netzkonzessionen inne haben. Auch die Kommunen und deren Bürger/innen haben Interesse an den Netzen, Rekommunalisierung steht hoch im Kurs. Viele Kommunen ergreifen von sich aus die Chance zum Netzrückkauf; andere werden von ihren Bürger/innen dazu angehalten, in Hamburg und Berlin sogar per Volksentscheid. So stellt sich die Frage: Könnten Energienetze in Genossenschaftshand einen demokratischen Mehrgewinn bieten?
Gehen wir zurück nach Berlin, wo beide Modelle angeboten werden. In Berlin befindet sich das Stromnetz derzeit im Vergabeverfahren. Zu den Bewerbern zählen unter anderen Vattenfall, die BEB sowie ein Unternehmen des Landes Berlin. Alle möchten wenigstens Anteile des Netzes erstehen. Doch wem steht das Stromnetz als Gemeingut eigentlich zu? Aus demokratischer Perspektive muss die Antwort lauten: denen, die das Netz nutzen, sprich den Berliner/innen. Sie sind auf ein gut funktionierendes Stromnetz angewiesen und müssen auf dessen Betreiber Einfluss nehmen können. Das ist am ehesten bei dem Landesunternehmen gegeben, denn es wurde von einer gewählten Landesregierung aufgestellt und gehört dem Land Berlin. Außerdem haben sich im vergangenen November beim Volksentscheid ganze 83 Prozent (rund 600.000) der Abstimmenden für die Vorlage des Berliner Energietisches ausgesprochen (siehe Seite 12). Zwar hat die Vorlage das hohe Zustimmungsquorum von 25 Prozent knapp verfehlt, doch das Ergebnis bleibt eine echte demokratische Willensbekundung des Souveräns, der sich mit großer Mehrheit für ein öffentlich betriebenes Netz aussprach. Der BEB fehlt dieser demokratische Rückhalt genauso wie den anderen privaten Bewerbern. Sie benötigen für eine realistische Chance auf Zuschlag keine Mehrheit unter den Bürger/innen, sondern – neben der Vorweisung von betriebswirtschaftlichen Kompetenzen – vor allem ausreichend Kapital.
Doch nicht nur die mangelnde demokratische Legitimation der Netzgenossenschaften ist problematisch. Auch die Genossenschaft als Unternehmensform würde – trotz Stimmgleichheit unter den Mitgliedern – mehr Demokratieprobleme erzeugen als lösen. Denn während im öffentlichen kommunalen Unternehmen alle wahlberechtigten Netz-Nutzer/innen gemeinsam und gleichberechtigt das Netz halten, erzeugt das Genossenschaftsmodell Ungleichheit. Erstens sind die Nutzer/innen nicht automatisch Mitglieder. Die Mitgliedschaft muss erst beantragt und von der Genossenschaft anerkannt werden, und sie kostet Geld – im Falle der BEB mindestens 500 Euro. Wenn aber nicht alle Nutzer/innen auch Genossenschaftler/innen wären, gäbe es Nutzer/innen erster und zweiter Klasse: mit und ohne Stimmrecht. Was die BEB als Beteiligungsmöglichkeit darstellt, kann von den Netz-Nutzer/innen auch als nötigend empfunden werden. Denn 500 Euro als Mindesteinlage sind für die meisten Menschen keine geringe Hürde.
Zweitens wären nicht alle Mitglieder auch Nutzer/innen, denn die Netz-Genossenschaften nehmen auch Mitglieder auf, die gar nicht im Netzbereich wohnen. Vor einem Jahr hatten 20 Prozent der BEB-Mitglieder ihren Wohnsitz nicht in Berlin. Diese Personen (zugelassen sind übrigens auch juristische Personen wie Unternehmen oder Vereine) könnten also in der Netzpolitik mitentscheiden, obwohl sie nicht von ihr betroffen wären – außer in finanzieller Hinsicht, in Bezug auf ihren Gewinn. Mit anderen Worten: Die Identität von Nutzer/innen, Eigentümer/innen und Verwalter/innen des Netzes wäre mit der BEB aufgelöst und mit ihr der demokratische Sinnzusammenhang.
Die Aufspaltung der Berliner/innen in Mitglieder und Nicht-Mitglieder der BEB würde zudem die wirtschaftliche Ungleichheit unter den Nutzer/innen verstärken. Gewinne aus dem Netzbetrieb würden privatisiert und von den Nicht-Mitgliedern zu den Mitgliedern fließen. Eine Begrenzung der Genossenschafts-einlage nach oben könnte die größte Ungleichheit verhindern, ist aber bei der BEB (im Gegensatz zu vielen anderen Genossenschaften) nicht vorgesehen. Man braucht das Geld. Derzeit stellen rund 1.700 Mitglieder rund acht Millionen Euro Kapital bereit (Stand November 2013). Im Durchschnitt sind das 4.700 Euro pro Mitglied. De facto werden einige Mitglieder weit mehr, die meisten weit weniger Geld eingebracht haben. Noch krasser sind die Verhältnisse in Hamburg. Dort verfügt die Netz-Genossenschaft „Energienetze Hamburg“ laut ihres Geschäftsführers über 50 Millionen Euro Eigenkapital „aus den Reihen der Mitglieder“ bei einer Mitgliederzahl „im dreistelligen Bereich“. Selbst wenn man die in dieser ungenauen Formulierung höchstmögliche Zahl von Mitgliedern – 999 – annimmt, entfällt auf ein Mitglied eine durchschnittliche Einlage von 50.000 Euro. So ausgestattet – und so intransparent – bewirbt sich die Genossenschaft auf einen Anteil an den Energienetzen Hamburgs, die kraft Volksentscheid im September 2013 eigentlich zu 100 Prozent rekommunalisiert werden sollen. Ihr vorgebliches Ziel dabei: die „Demokratisierung der Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse“. Doch würde die Genossenschaft den Entscheid ernst nehmen, müsste sie ihre Bewerbung eigentlich zurückziehen.
Auch wenn die Netz-Genossenschaften die Aussicht auf Rendite gegenüber dem höheren Ziel der Energiewende stets als nachrangig darstellen – sie locken mit „nachhaltigen Gewinnen“. Sie sind ausdrücklich offen für „große, strategische Investoren wie Pensionsfonds und Rentenkassen“. Solche Großinvestoren würden allerdings die Ausschüttungen auf ein höheres Niveau treiben, als es der Energiewende-Idealismus und die Netz-Nutzer/innen gern sähen. Insgesamt werden die Netz-Genossenschaften einer Aktiengesellschaft immer ähnlicher.
Dies alles spricht nicht gegen Genossenschaften im Bereich Energie, wohl aber gegen Genossenschaften als Käufer und Betreiber von Energienetzen. Aufgestellt als Kapitalgesellschaften unterminieren Netz-Genossenschaften die demokratische kommunale Selbstbestimmung. Weil die Netze als natürliche Monopole von besonderem öffentlichen Interesse sind, sollten Eigentum und Kontrolle nicht bei Kapitalgeber/innen liegen, sondern bei den Nutzer/innen, also in öffentlicher Hand. Eine auf Nutzer/innen ausgerichtete Rechtsform ist etwa die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Die demokratische Kontrolle solcher öffentlicher Unternehmen auszugestalten ist eine Aufgabe, der sich die Zivilgesellschaft verstärkt annehmen sollte. Eine richtungsweisende Idee hierzu stammt vom Berliner Energietisch. Dieser schlägt die Überführung des Berliner Stromnetzes in eine Netz-AöR vor, legitimiert durch die Berliner Nutzer/innen über allgemeine (teilweise direkte) Wahlen und kontrolliert über ein Initiativrecht sowie hohe Transparenz. Ausschüttungen von Gewinnen an private Anteilseigner/innen gäbe es nicht, so dass mehr Geld in das Gemeingut Stromnetz reinvestiert werden könnte. Durch die Übereinstimmung von Nutzer/innen-, Eigentümer/innen- und Verwalter/innen-Gemeinschaft würde die demokratische kommunale Selbstbestimmung gestärkt und damit die Identifikation der Bürger/innen mit ihrer kommunalen Netzbetreiberin.
Auch hier würden freilich Probleme entstehen, wenn auch andere. Doch diese anzugehen läge dann, genau wie das Netz, wirklich „in Bürgerhand“.
Dr. Percy Vogel, Jahrgang 1966, ist Vorstand von BürgerBegehren Klimaschutz e.V. und Mitglied in drei Genossenschaften (jedoch keiner Netzgenossenschaft).