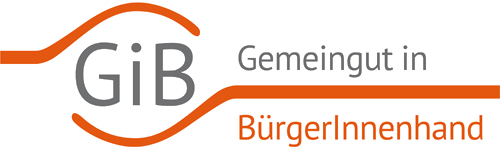Von Daniel Gräber aus der Zeitung „Der Sonntag“ (19. Mai 2013)
Wer die deutsche Rechtsprechung sinnvoll durchsuchen will, zahlt dafür viel Geld. Ein Datenbankbetreiber aus Gundelfingen schickt sich an, dies zu ändern. Mit einer Klage gegen das höchste deutsche Gericht.
Mit Gerichtsurteilen lässt sich Geld verdienen. Viel Geld. Erst recht, wenn man die Möglichkeiten des Internets nutzt und die Rechtsprechung in Datenbanken ordnet, gut durchsuchbar aufbereitet sowie zusammenhängende Urteile miteinander verknüpft. Das hat Softwareentwickler Christoph Schwalb schon vor 15 Jahren erkannt und gründete in Gundelfingen die Firma Lexxpress. Doch er scheiterte daran, dass die staatlichen Lieferanten des Datenmaterials einen Konkurrenten bevorzugen: die Juris GmbH. Exklusiv-Verträge mit den obersten Gerichten ließen Juris zum „Marktführer für Online-Rechtsinformationen in Deutschland“ (laut eigener Darstellung) heranwachsen. Mit jährlich steigenden Gewinnen in Millionenhöhe. Denn wer die Urteils-Datenbank durchsuchen will, muss bezahlen. Rechtsanwaltskanzleien können sich die hohen Abogebühren leisten. Aber der normale Bürger, der Urteile zu einer bestimmten Rechtsfrage suchen will, ist praktisch ausgeschlossen.
Dass die staatlichen Exklusiv-Verträge mit Juris öffentlich wurden, ist Christoph Schwalbs Hartnäckigkeit zu verdanken. Denn er zog vor Gericht – gegen die Gerichte. Und er gab trotz zahlreicher Niederlagen nicht auf, jahrelang nicht. Vergangene Woche ist ihm ein Erfolg gelungen, der bundesweit noch für Aufsehen sorgen wird: Er hat das Bundesverfassungsgericht besiegt. Zumindest vorläufig, denn das höchste deutsche Gericht könnte in Revision gehen. Aber ob es das tun wird, ist nicht nur eine juristische, sondern vor allen Dingen eine politische Frage: Der Ruf des Rechtsstaats steht auf dem Spiel. Und das ausgerechnet durch das Geschäftsgebahren derjenigen Institution, die ihn sonst als sein Bollwerk verteidigt.
Warum es überhaupt so weit kommen konnte, erklärt sich Christoph Schwalb so: „Das ist ein gut funktionierendes Kartell, von dem beide Seiten profitieren.“ Die Firma Juris spart einiges an Personalkosten, weil die Dokumentationsabteilungen der Justiz die Urteile inhaltlich und technisch so aufbereiten, dass sie direkt in die Datenbank übernommen werden können. Ein amtlicher Service, der anderen Anbietern nicht gewährt wird. Genau dagegen hat Schwalb nun erfolgreich geklagt. Nicht aus wirtschaftlichem Interesse, sagt er. Seine Firma habe inzwischen ein anderes Geschäftsmodell gefunden. „Sondern weil ich es für skandalös halte.“
Die Justiz profitiert von der Zusammenarbeit, weil sie dadurch die Kosten einer eigenen Datenbank einspart. Und auch ein guter Teil der Gewinne, die Juris durch den Urteilsverkauf erwirtschaftet, geht an das Bundesjustizministerium. Ursprünglich war die Rechtsdatenbank vollständig in öffentlicher Hand, wurde aber scheibchenweise privatisiert. Mit 50,01 Prozent der Anteile hält der Bund noch eine knappe Mehrheit an der Juris GmbH. Rund 45 Prozent der Anteile gehören inzwischen einem niederländischen Verlag, der wiederum in den Händen privater Finanzinvestoren ist.
Kritiker dieses Modells bemängeln, ein Rechtsstaat dürfe seine Urteile nicht wie eine Handelsware verkaufen. Stattdessen sollte er im Internetzeitalter dafür sorgen, dass alle Bürger unbeschränkten Zugang zu einer bundesweiten Rechtsdatenbank haben. In anderen EU-Ländern ist dies schon Realität.
Bedenken aus den eigenen Reihen
Aber selbst Markt-Befürworter, die gegen die Privatisierung von Urteilsdaten nichts einzuwenden haben, sehen die Juris-Konstruktion kritisch. Denn der mögliche Vorteil eines Marktes, sinkende Preise durch Wettbewerb, wird ausgehebelt. Durch undurchsichtige Exklusiv-Verträge, ohne Ausschreibung, ohne Vergabeverfahren. Das Bundesjustizministerium hat bisher alle Einwände zurückgewiesen. Selbst solche aus den eigenen Reihen.
Als Christoph Schwalb Anfang 1999 das Bundesverfassunsgericht aufforderte, seiner Firma Lexxpress die Gerichtsentscheidungen im selben Umfang und in derselben aufbereiteten Form wie der Juris GmbH zukommen zu lassen, lehnte die damalige Gerichtsdirektorin Elke Luise Barnstedt dieses Anliegen ab. Dabei berief sie sich auf das Bundesjustizministerium. Doch gleichzeitig äußerte sie intern erhebliche Zweifel an dessen Haltung: „Meines Erachtens sieht das Bundesministerium der Justiz nicht, dass es problematisch sein könnte, ausschließlich einer privatrechtlichen GmbH Leistungen zu überlassen“, schreibt Barnstedt in einem Vermerk vom 12. Februar 1999. In Klammern fügt sie hinzu: „Erhebliche Ressourcen vom Bundesverfassungsgericht fließen in die Bearbeitung der Dokumentation.“ Ressourcen, für die der Steuerzahler bezahlt.
Und auch dem Hauptargument für die Exklusiv-Belieferung widerspricht die Direktorin klar und deutlich: Soweit das Ministerium darauf verweise, dass „wir im Gegenzug freie Benutzung der Juris-Datenbank erhalten, hilft dies uns meines Erachtens nur wenig, da auch der Haufe-Verlag dies uns anbieten könnte.“ Der Freiburger Haufe-Verlag hatte sich Ende 1998 ebenfalls um die Herausgabe der Juris-Daten bemüht. Allerdings mit kürzerem Atem als Christoph Schwalb.
Warum wurden innerhalb des Bundesverfassungsgerichts Barnstedts Bedenken nicht ernst genommen, was nun zur Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg geführt hat? Weder Barnstedt selbst noch der Sprecher des Gerichts nehmen dazu Stellung. Man warte auf die Urteilsbegründung der Mannheimer Verwaltungsrichter, heißt es aus Karlsruhe. Aber es sei ganz normal, dass es in einer so komplexen Rechtsfrage unterschiedliche Auffassungen gebe. Es wirkt, als sei man sich der politischen Dimension dessen, was Kartell-Bekämpfer Schwalb ins Rollen gebracht hat, noch gar nicht bewusst.
Einer seiner Anwälte, der Freiburger Urheberrechtler Michael Nielen, hofft, dass sich dies ändern wird: „Wie das Bundesverfassungsgericht an der juristisch und moralisch falschen Praxis seiner Urteilsveröffentlichung festhält, ist seiner nicht würdig. Ich gehe davon aus, dass das den Richtern nach der Lektüre der Entscheidung aus Mannheim klar wird.“ Bei der mündlichen Verhandlung hat kein Verfassungsrichter, sondern der Leiter der Dokumentationsabteilung das höchste deutsche Gericht vertreten.